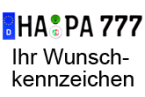Die kommunale Wärmeplanung soll künftig die Grundlage für die Planung und Steuerung der Wärmewende auf kommunaler Ebene bilden. Ziel ist es, einen konkreten Plan zu entwickeln, um die Herausforderungen einer flächendeckenden treibhausgasneutralen Wärmeversorgung bis 2045 strategisch anzugehen. Der Rat der Stadt Hagen hat daher im Februar 2023 beschlossen, einen kommunalen Wärmeplan aufzustellen.
Hier finden Sie folgende Informationen:
- Was ist kommunale Wärmeplanung?
- Arbeitsschritte der kommunalen Wärmeplanung
- Gesetzliche Rahmenbedingungen: GEG und WPG / LWPG
- Stand der Wärmeplanung in Hagen
- Was kann ich als private*r Eigentümer*in von Gebäuden und Wohnungen tun, bis die Wärmeplanung vorliegt?
- FAQ: Häufige Fragen zur kommunalen Wärmeplanung
- Partnerkommune im Verbundprojekt »KommWPlanPlus«
Was ist kommunale Wärmeplanung?
Die kommunale Wärmeplanung ist ein strategischer Prozess zur Umstellung der Wärmeversorgung auf erneuerbare Energien und zur Nutzung von Energieeinsparpotenzialen. Ziel ist eine treibhausgasneutrale Wärmeversorgung bis 2045 durch die Reduktion fossiler Energien und die verstärkte Nutzung von Alternativen wie Geothermie, Solarthermie und industrieller Abwärme.
Der Wärmeplan zeigt auf, wo und wie in Hagen eine treibhausgasneutrale Wärmeversorgung erreicht werden kann. Er berücksichtigt lokale Gegebenheiten wie verfügbare Flächen für Solarthermie oder geothermische Quellen. Ein gesetzlicher Rahmen durch das Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung (WPG / LWPG) gibt eine Orientierung, doch die spezifischen lokalen Potenziale und Bedingungen werden in Hagen detailliert analysiert. Ziel ist es, bestehende Wärmenetze zu optimieren, neue aufzubauen und die Wärmeversorgung nach und nach von fossilen Brennstoffen zu lösen. Dafür ist die Kooperation von städtischen Abteilungen, Energieversorgern, Unternehmen und der Bürgerschaft essenziell.
Mit der Wärmeplanung wird Hagen einen strategischen Pfad einschlagen, der die Stadt auf eine klimaneutrale Zukunft ausrichtet und dabei auch die lokale Wirtschaft und die Bürger*innen eng einbindet.
Arbeitsschritte der kommunalen Wärmeplanung
Die Wärmeplanung in Hagen erfolgt in vier wesentlichen Schritten:
1. Bestandsanalyse
Um den Wärmebedarf in Hagen zu ermitteln, wird der aktuelle Gebäudebestand erfasst. Dabei werden Faktoren wie Baualtersklassen, Beheizungsstruktur und Energieverbrauch analysiert. Die Ergebnisse bilden die Grundlage für die Identifizierung von Einsparpotenzialen.
2. Potenzialanalyse
Im nächsten Schritt werden Möglichkeiten zur Reduktion des Wärmebedarfs durch energetische Sanierungen und die Nutzung erneuerbarer Wärmequellen geprüft. Hierbei geht es um Geothermie, Solarthermie, Abwasserwärme und grünen Wasserstoff.
3. Entwicklung von Zielszenarien
Mehrere Szenarien werden entwickelt, um aufzuzeigen, wie Hagen eine klimaneutrale Wärmeversorgung erreichen kann. Dabei werden zentrale und dezentrale Heizlösungen wie Fernwärme oder Wärmepumpen in unterschiedlichen Stadtteilen betrachtet.
4. Entwicklung einer Wärmewendestrategie
Auf Basis der Analyseergebnisse wird ein Transformationspfad für die Wärmeversorgung in Hagen erstellt. Dieser beschreibt, welche Maßnahmen in welchen Zeiträumen umgesetzt werden müssen, um eine sozialverträgliche und kosteneffiziente Umstellung zu erreichen.
Gesetzliche Rahmenbedingungen: GEG und WPG / LWPG
Die Bundesregierung hat im Frühjahr 2023 beschlossen, das Gebäudeenergiegesetz (GEG) eng mit dem Gesetz zur Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung derWärmenetze (WPG) zu verknüpfen. Kommunen müssen eine Wärmeplanung vorlegen, bevor die Vorgaben des GEG greifen. In Städten mit mehr als 100.000 Einwohner*innen, wie Hagen, muss der Wärmeplan bis spätestens 30. Juni 2026 vorliegen. Das WPG verpflichtet zudem die Netzbetreiber, die Wärmeerzeugung klimafreundlich zu gestalten. Das Gesetz trat am 1. Januar 2024 in Kraft.
Im Februar 2023 hat der Rat der Stadt die Verwaltung damit beauftragt, eine Förderung für eine kommunale Wärmeplanung für die Stadt Hagen zu beantragen (Ratsbeschluss vom 09.02.2023, Drucksache 0101/2023).
Die Wärmeplanung stellt die wesentliche Grundlage dar für alle Entscheidungen, wie in Hagen zukünftig geheizt werden kann. Im August 2023 erhielt die Stadt Hagen eine Förderzusage durch Bundesmittel der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) zur Erstellung des Wärmeplans. Aber im Oktober 2024 hat das Wirtschaftsministerium NRW die Förderung für alle Kommunen gestoppt, da über das in Kraft getretene Wärmeplanungsgesetz des Bundes und des Landes NRW eine gesetzliche Verpflichtung besteht und eine Einigung erzielt wurde, diese über Bundesmittel ab 2025 zu finanzieren.
Die Fertigstellung der Wärmeplanung in Hagen wird 2026 angestrebt.
Die Verwaltung wird in den betreffenden Ausschüsse regelmäßig detailliert über den aktuellen Stand informieren. Diese Mitteilungen für die politischen Gremien finden Sie dann im Bürgerinformationssystem der Stadt Hagen.
Was kann ich als private*r Eigentümer*in von Gebäuden und Wohnungen tun, bis die Wärmeplanung vorliegt?
Sie sind gesetzlich nicht verpflichtet, Ihre Heizung sofort zu tauschen. Die Novelle des bundesweiten Gebäudeenergiegesetzes (GEG) sieht nur für neu eingebaute Heizungen vor, dass diese mit mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Reparaturen alter Heizungen sind insofern möglich. Sollte Ihre Heizung ausfallen, gibt es verschiedene Übergangsfristen. Einen guten allgemeinen Überblick zu effizienten Gebäuden finden Sie auf den Seiten des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) .
Sie haben also in aller Regel Zeit abzuwarten, bis eine kommunale Wärmeplanung vorliegt. Diese macht Ihnen die Entscheidung für eine Heizungsvariante voraussichtlich deutlich einfacher.
Droht Ihre Heizung unreparierbar auszufallen („Heizungshavarie“), oder wollen Sie schon jetzt umsteigen, dann haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Sie informieren sich frühzeitig darüber, ob Sie sich schon an ein Fernwärmenetz anschließen lassen können. Wenden Sie sich hierfür bitte an die ENERVIE oder die E.ON Energy Solutions GmbH.
- Vielleicht können und wollen Sie sich auch als Nachbarschaft zusammenschließen und gemeinsam einen Antrag stellen, um die Anschlusskosten zu senken.
- Sie finden eine individuelle Wärmelösung für Ihr Haus. Das kann eine Wärmepumpe sein, deren Betrieb auch im Bestandsgebäude technisch und wirtschaftlich machbar ist.
Auch wenn Ihre Heizung noch intakt ist, sollten Sie beginnen, Schritt für Schritt das Dach, die oberste Geschossdecke, die Kellerdecke und die Außenwände zu dämmen sowie Fenster und Türen zu erneuern. So bleibt kostbare Heizwärme im Haus und Ihre jährlichen Heizwärmekosten werden deutlich sinken. Eine solche energetische Sanierung ist auch im Altbau möglich und bei einem Anschluss an die Fernwärme notwendig, damit die Wärme in Zukunft effektiv von allen genutzt werden kann.
Solche und andere Maßnahmen können beispielsweise über die Bundesförderung Effiziente Gebäude (BEG) des BAFA gefördert werden. Eine umfassende Präsentation dazu bietet die NRW.Energy4Climate. Zu Möglichkeiten und Förderung berät Sie ebenfalls die Verbraucherzentrale Hagen.
FAQ: Häufige Fragen zur kommunalen Wärmeplanung
Ihre Wohnsituation:
Welche Bedeutung hat das Wärmeplanungsgesetz und das Gebäude-Energie-Gesetz für mich als Hausbesitzer?
Die Einführung des Wärmeplanungsgesetzes sowie die Novellierung des Gebäude-Energie-Gesetzgesetzes (GEG) haben unmittelbar unterschiedliche Auswirkungen auf Hausbesitzer oder Mieter. Die Gesetze gelten für Wohngebäude und Nicht-Wohngebäude gleichermaßen.
Durch das Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung ergibt sich erstmal kein Aufwand für Bürger:innen. Es müssen auch keine neuen Daten für die Erstellung von kommunalen Wärmeplänen erhoben werden. Diese liegen den Energieversorgern, Städten und Schornsteinfeger:innen bereits vor.
Das Gebäude-Energie-Gesetz hingegen löst bereits zum 01.01.2024 Wirkung aus. Ziel ist der schrittweise Umstieg auf eine klimaneutrale Wärmeversorgung.
Es gelten unterschiedliche Übergangsfristen nach dem GEG, je nachdem ob es sich um einen Neubau in einem Neubaugebiet oder ein Bestandsgebäude und Neubau im Bestandsgebiet (z.B. Baulücken) handelt. Neubauten, die in Baulücken errichtet werden, werden vom Gesetz behandelt wie Bestandsgebäude. Zugleich hängen diese Übergangsfristen unmittelbar mit der kommunalen Wärmeplanung zusammen. (siehe weitere Fragen)
Ich wohne im Bestand und meine Heizung funktioniert, muss ich nun eine Wärmepumpe kaufen?
Nein, für Bürger:innen mit einem Bestandsgebäude mit einer funktionierenden Heizung, entstehen zunächst keine Konsequenzen durch das GEG. Die Anforderungen der 65%-Regelung des GEG für Bestandsgebäude sollen frühestens nach Ablauf der gesetzlichen Fristen zur Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung gelten - d.h. in Solingen frühestens ab Mitte 2026.
Eine funktionierende fossile Heizung, die vor 2024 und nach 1991 eingebaut wurde, kann bis Ende 2044 weiterhin genutzt werden. Wenn die Brenneranlage defekt ist, aber durch Reparatur wieder funktionsfähig gemacht werden kann, braucht es keinen Austausch.
Wenn die Anlage kaputtgeht und eine neue Anlage eingebaut werden muss, gelten Übergangsfristen von bis zu 5 Jahren, um eine Lösung gemäß der 65 %-Regel zu finden. In der Zwischenzeit ist beispielsweise der Einbau einer gebrauchten oder geliehenen Heizung erlaubt. Es ist jedoch empfehlenswert, sich frühzeitig über den Stand der kommunalen Wärmeplanung zu informieren und dies in die Entscheidung mit einzubeziehen.
Sobald die Stadt Solingen einen Beschluss über die Ausweisung eines Gebietes zum Neu- oder Ausbau eines Wärmenetzes oder als Wasserstoffnetzausbaugebiet auf der Grundlage eines Wärmeplans vor Mitte 2026 getroffen hat, sind die 65% - Anforderungen an neue Heizsysteme für die betroffenen Gebäude verbindlich. Bis der Anschluss an ein neu- oder auszubauendes Netz möglich ist, gibt es Übergangsfristen, welche von den genauen Ausbaufahrplänen der Netzbetreiber abhängen.
Wichtig: Ein Wärmeplan alleine löst die Verpflichtung noch nicht aus. Vielmehr bedarf es einer kommunalen Bekanntgabe über die Ausweisung als Gebiet zum Neu- oder Ausbau eines Wärmenetzes oder als Wasserstoffnetzausbaugebiet (in Form einer Satzung). Nach einem Monat nach Bekanntgabe der Gebietsausweisung sind die Verpflichtungen nach GEG einzuhalten.
(Quelle: BMWK)
Ich plane einen Neubau und stelle meinen Bauantrag nach dem 01.01.2024 – was heißt das jetzt für mich?
Für Bürger:innen, die einen Neubau (im Neubaugebiet) planen, ergeben sich durch das GEG neue Voraussetzungen an die Gebäudedämmung sowie das geplante Heizsystem. In einem ausgewiesenen Neubaugebiet gelten ab dem 01.01.2024 die Erfüllungsoptionen nach §71 GEG (Anforderungen der 65%-Regelung). Insgesamt sieht das Gesetz sieben Erfüllungsoptionen vor, darunter den Anschluss an ein Wärmenetz, eine Wärmepumpe, eine Stromdirektheizung (nur in gut gedämmten Gebäuden), eine Biomasseheizung (Holz, Hackschnitzel und Pellets), Hybridsysteme wie Wärmepumpen- oder Solarthermie-Hybridheizung (Wärmepumpe oder solarthermische Anlage kombiniert mit einem mit Öl oder Gas betriebenen (Spitzenlast)Heizkessel, oder mit einer Biomasseheizung), Heizung auf der Basis von Solarthermie (falls Wärmebedarf damit komplett gedeckt wird), Gasheizung, die nachweislich mindestens 65 % Biomethan oder biogenes Flüssiggas nutzen kann. Dieser Fall trifft in Solingen aktuell nicht zu, sondern wird erst wieder bei der Neuerschließung von Baugebieten relevant.
(Quelle: BMWK)
Ich baue in einer Baulücke – was gilt nun für mich?
Wenn Sie einen Neubau in einem bestehenden Gebiet, also in einer Baulücke, planen, so gelten für Sie die gleichen Übergangsfristen wie bei einem Bestandsgebäude. Die 65 % Regel gilt demnach für neuinstallierte Heizungen erst, sobald der Wärmeplan vorliegt. Bis zum Vorliegen des Wärmeplans besteht weiterhin die rechtliche Möglichkeit, Gasheizungen zu installieren, sofern diese später auf Wasserstoff umgerüstet werden können. Ab 2024 ist jedoch vor dem Einbau eine Beratung erforderlich, die über die voraussichtlich steigenden Kosten und ökologisch und ökonomisch sinnvolle Alternativen informiert. Im Falle eines Defekts oder eines geplanten Austauschs haben Hausbesitzer:innen eine Übergangsfrist von 5 Jahren, um eine neue Heizung mit einem Anteil von 65 % regenerativer Energien zu installieren. In der Zwischenzeit ist beispielsweise der Einbau einer gebrauchten oder geliehenen Heizung erlaubt. Es empfiehlt sich jedoch frühzeitig, sich über den Stand der kommunalen Wärmeplanung zu informieren und dies in die Entscheidung mit einzubeziehen.
(Quelle: BMWK)
Woher weiß ich, welche neue Heizung die beste Option für mich ist?
Welche der Erfüllungsoptionen nach dem GEG sich am besten für Ihr Gebäude eignet, lässt sich idealerweise durch zertifizierte Energieberatung im persönlichen Gespräch erörtern. Zum Teil können Sie sich Beratungen durch das BMWK fördern lassen. Hier finden sich Infos unter: www.energie-effizienz-experten.de. Gleichzeitig kann aus einem kommunalen Wärmeplan abgelesen werden, für welche Versorgung das Gebiet, in dem Ihr Haus sich befindet, idealerweise geeignet ist. Diese Information kann in die Beratungsangebote von Verbraucherzentrale bzw. Gebäudeenergieberater:innen einfließen.
Ich habe eine sehr alte Heizung, was gibt es zu beachten?
Wenn die Heizungsanlage früher als 1991 eingebaut wurde, darf sie nicht mehr weiter betrieben werden. Wenn die Heizung nach 1991 eingebaut wurde, darf sie nach Ablauf von 30 Jahren nicht mehr betrieben werden. Dabei gibt es Ausnahmen für Niedertemperatur-Heizkessel und Brennwertkessel sowie für Heizungsanlagen mit einer Nennleistung von weniger als 4 oder mehr als 400 Kilowatt.
Zusätzlich gibt es eine Ausnahme für Eigentümer:innen von Ein- und Zweifamilienhäusern, die das Gebäude seit mindestens dem 1. Februar 2002 selbst bewohnen. Im Fall eines Eigentümerwechsels nach dem 1. Februar 2002 muss jedoch der/die neue Eigentümer:in den Heizungskessel bis spätestens zwei Jahre nach dem Eigentumsübergang außer Betrieb nehmen.
Welche Auswirkungen hat die Wärmeplanung auf meine Miete?
Bei Modernisierung der Heizungsanlage kann die / der Vermieter:in die Kosten der Modernisierung auf die Mieter:innen umlegen. Das GEG sowie eine Anpassung des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) sieht vor, dass die umlegbaren Kosten für die Modernisierung der Heizungsanlage auf maximal 0,5 Euro/m² gedeckelt sind. Wenn weitere Modernisierungsmaßnahmen getätigt werden, kann die Miete um insgesamt max. 3 Euro/m² innerhalb von 6 Jahren steigen. Eine ausführliche Übersicht vom deutschen Mieterbund finden Sie hier.
(Quelle: BMWK)
Ich muss meine Heizung kurzfristig ersetzen. Welche Fördermöglichkeiten gibt es?
Zu beachten: Ab 2024 ist beim Einbau einer mit fossilen Energieträgern betriebenen Heizung eine fachkundige Beratung erforderlich.
Zu beachten: Mit Abschluss der kommunalen Wärmeplanung liegt eine strategische Planung vor, die die wirtschaftlichste erneuerbare Wärmelösung für Ihr Quartier empfiehlt.
Fördermittel können z. B. beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle BAFA und bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) beantragt werden.
Das BAFA bietet eine Förderung für Wärmepumpenanlagen von bis zu 35 % der förderfähigen Kosten an.
Die KfW bietet Zuschüsse für klimafreundliche Wärmelösungen mit bis zu 70 % der förderfähigen Kosten sowie Kredite an.
Weitere Infos zu den Fördermöglichkeiten unter:
Wie kann ich als Eigentümer*innen, bevor die kommunale Wärmeplanung vorliegt, Maßnahmen ergreifen, um mein Gebäude zukunftsfähig zu machen?
- Prüfen Sie die Möglichkeit eines Anschlusses an ein bestehendes oder geplantes Fernwärmenetz.
- Falls kein Fernwärmenetz-Anschluss möglich oder absehbar ist, informieren Sie sich über Fördermöglichkeiten für Wärmepumpen oder andere individuelle Lösungen (siehe FAQ).
- Beginnen Sie schrittweise mit energetischen Sanierungen, um den Wärmebedarf Ihres Gebäudes langfristig zu reduzieren und Kosten zu senken.
Hintergründe:
Was ist die kommunale Wärmeplanung?
Die kommunale Wärmeplanung ist ein informelles (= rechtlich nicht direkt bindendes) Instrument, dass den Kommunen an die Hand gegeben wird. Mit ihr soll der Grundbaustein für den Umbau der lokalen Wärmeversorgung gelegt werden. Ziel ist es, langfristige Pfade für eine klimaneutrale Wärmeversorgung zu entwickeln. Perspektivisch sollen diese in Kooperation mit den Stadtwerken, Energieversorgern sowie Gebäudeeigentümer:innen umgesetzt werden.
(Quelle: BMWSB)
Ab wann und für wen gilt die Pflicht zur kommunalen Wärmeplanung?
Die Pflicht einen Wärmeplan zu erstellen, gilt für Kommunen ab 10.000 Einwohner:innen. Städte bis 100.000 Einwohner:innen haben die Pläne bis spätestens zum 30.06.2028 aufzustellen, Städte ab 100.000 Einwohner:innen, wie Solingen, bis zum 30.06.2026. Für kleinere Kommunen unter 10.000 Einwohner:innen wird es die Möglichkeit zu vereinfachten Verfahren geben. (Quelle: BMWSB).
Hagen hat weit über 100.000 Einwohner:innen und ist daher verpflichtet, einen Wärmeplan bis zum 30.06.2026 aufzustellen.
Wie funktioniert die kommunale Wärmeplanung
Der kommunale Wärmeplan soll zeigen, wo und wie eine klimaneutrale Wärmeversorgung unter Nutzung erneuerbarer Energieträger und unvermeidbarer Abwärme auf dem Stadtgebiet aussehen kann. Da die Möglichkeiten für eine klimaneutrale Wärmeversorgung von verschiedenen Rahmenbedingungen abhängen, wie beispielsweise dem Vorhandensein von Flächen für Solarthermie oder geothermischen Quellen, gibt das Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung nur einen Rahmen vor. Inhaltlich sollen die lokalen Potenziale und Gegebenheiten berücksichtigt und ausgeschöpft werden, so beispielsweise die Möglichkeit an bestehende Wärmenetze anzu-knüpfen oder neue auszubauen und die Wärmeerzeugung der Netze zeitlich gestaffelt zu dekarbonisieren, also von fossilen Energien unabhängig zu machen.
Deswegen ist die Kooperation von allen städtischen Abteilungen, den städtischen Betrieben, den Energieversorgern sowie den Unternehmen und Bürger:innen vor Ort wichtig.
Die kommunale Wärmeplanung folgt dabei den folgenden Schritten:
1. Schritt: Bestandsanalyse
2. Schritt: Potenzialanalyse
3. Schritt: Zielszenario
4. Einteilung in Wärmeversorgungsgebiete („Wärmeplan“)
5. Entwicklung einer Umsetzungsstrategie
(Quelle: BMWSB)
Was ist das Ergebnis der kommunalen Wärmeplanung?
Das Ergebnis ist eine Karte, die anzeigt, wo zukünftig geeignete Orte für z. B. „Wärmenetzgebiete“ oder „Gebiete für die dezentrale Wärmeversorgung“ entstehen könnten und mit welchen potentiellen Energieträgern (z. B. Geothermie, Strom, …) diese versorgt werden könnten.
Der kommunale Wärmeplan gibt Orientierung für Investitionsentscheidungen, etwa zur Anschaffung einer Wärmepumpe oder ob man sich um einen Anschluss an das lokale Wärmenetz kümmern sollte.
Beispiele finden Sie beim Kompetenzzentrum Wärmewende.
Quelle: KWW / dena
Wie kann man Möglichkeiten und Grenzen der Wärmeplanung umreißen?
Die Wärmeplanung ist ein strategisches Mittel, um Leitplanken der Versorgung und Schwerpunkte des Ausbaus und Umbaus der Infrastruktur zu setzen. Antworten auf alle Fragen oder gar einen 20 Jahre gültigen Masterplan darf man jedoch nicht erwarten. Die Darstellung von Eignungsgebieten für die dezentrale oder zentrale Wärmeversorgung in einem vom Stadtrat verabschiedeten Wärmeplan sind zunächst nicht rechtsverbindlich. Sie werden erst rechtswirksam, wenn explizite Beschlüsse über die Ausweisung von Gebieten als Wärmenetzgebiete oder als Wasserstoffnetzausbaugebiete vom Stadtrat gefasst werden. Eine Detailanalyse für alle Gebäude einer Kommune kann im Rahmen der Wärmeplanung nicht geleistet werden. Unsicherheiten bezüglich künftiger Energiepreise, Umsetzungskapazitäten und Fördermodalitäten bleiben auch mit einer noch so guten Wärmeplanung bestehen.
Was eine Wärmeplanung leisten kann:
- Strategie für die CO2-freie, sichere und wirtschaftliche Wärmeversorgung
- Festlegung von Eignungsgebieten für Wärmenetze und dezentrale Versorgung (Wärmepumpen, Pelletkessel)
- Priorisierung von Maßnahmen
- Leitlinie für die Stadtentwicklung und Stadtplanung
- Zielvorgabe für Ausbau und die Umstellung auf erneuerbare Wärmenetze
- Orientierung für den Stromnetzausbau
- Orientierung für Bauherr:innen und Hauseigentümer:innen
- Orientierung für städtische Förderprogramme
Was eine Wärmeplanung nicht leisten kann:
- Ausbaugarantie geben für alle dargestellten Wärmeversorgungsgebiete – weder für Wärmenetze noch für Wasserstoff
- Anschluss- und/oder Termingarantien für Wärmenetzanschlüsse geben
- Einzelfallprüfungen auf Gebäudeebene durchführen => die Wärmeplanung ersetzt keine Gebäudeenergieberatung
(Quelle: ENERKO)
Was ist das Gebäude-Energie-Gesetz (GEG)?
Das Gebäude-Energie-Gesetz (GEG) ist eine gesetzliche Regelung, die seit dem 1. November 2020 in Kraft ist und 2023 novelliert wurde. Es vereint die bisherigen Vorschriften der Energieeinsparverordnung (EnEV), des Energieeinsparungsgesetzes (EnEG) und des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes (EEWärmeG) zu einem einheitlichen Gesetz. Das GEG gilt für alle beheizten oder klimatisierten Gebäude und legt hauptsächlich Anforderungen an die Heizungstechnik und den Wärmedämmstandard fest. Zum 01.01.2024 gilt die Novellierung des GEG. Dabei wird die sog. „65%-Regel“ eingeführt, nach den Heizungen zu mindestens 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden sollen. Das Gesetz definiert verschiedene Erfüllungsoptionen. Dazu gehören unter anderem Fernwärme, Wärmepumpen und Solarthermie. Die Regelungen unterscheiden sich je nachdem, ob man einen Neubau plant oder in einem Bestandsgebäude lebt.
(Quelle: Verbraucherzentrale)
Was sind fossilfreie bzw. erneuerbare Wärmequellen?
Fossilfreie bzw. erneuerbare Wärmequellen gemäß dem Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung (WPG) umfassen verschiedene nachhaltige Energiequellen. Dazu gehören
- Geothermie, die Wärme direkt aus dem Erdreich gewinnt,
- Umweltwärme aus Luft, Wasser oder technischen Prozessen,
- Abwasser als Wärmequelle aus der Kanalisation bzw. Kläranlagen,
- Solarthermieanlagen,
- Biomasse,
- grünes Methan (Methan aus grünem Wasserstoff und/oder aus der Vergärung von biogenen Reststoffen),
- Wärmepumpen,
- erneuerbarer Strom
- grüner Wasserstoff.
(Quelle: Wärmeplanungsgesetz WPG)
Welche Wärmenetze gibt es?
Grundsätzlich beschreibt ein Wärmenetz die Verteilung von thermischer Energie (Wärme) in Form von Wasserdampf oder heißem Wasser, von einer zentralen Erzeugungsquelle durch ein Rohrnetz an mehrere Gebäude oder Anlagen zur Nutzung von Raumwärme oder Warmwasser.
Dabei kann zwischen verschiedenen Formen unterschieden werden:
Zur Unterscheidung von Nah- und Fernwärme gibt es keine gesetzliche Definition oder einheitlichen Abgrenzungswerte. Meistens wird damit die Größe des Wärmenetzes bemessen. Nahwärmenetze beschreiben meistens Wärmenetze, die in zusammenhängenden (Wohn-)gebieten liegen und deren Leitungslänge einen Kilometer nicht überschreitet. Fernwärmenetze erstrecken sich dagegen über ganze Stadtgebiete. Jedoch wird der Begriff häufig synonym verwendet.
Neben der Länge des Netzes, kann auch nach der Übertragungstemperatur unterschieden werden. Dabei gibt es Hochtemperaturnetze, die Wasserdampf oder Heißwasser mit mehr als 100 °C Vorlauftemperatur transportieren. Wesentlich effizienter sind warme Wärmesysteme, die Wasser mit Vorlauftemperaturen zwischen 30-70 °C transportieren. Kalte Wärmenetze (oder auch Wärmenetze der 5. Generation) stellen eine neue Form der Wärme- und Kälteübertragung dar. Sie eignen sich insbesondere für die Verteilung von Wärme, die durch erneuerbare Energien bereitgestellt wird, da hier Vorlauftemperaturen von 0-10 °C genutzt werden. Hierzu bedarf es einer Kombination mit dezentralen Wärmepumpen, die innerhalb der Gebäude das Wasser auf die notwendige Nutztemperatur erwärmen.
(Quelle: IFEU)
Partnerkommune im Verbundprojekt »KommWPlanPlus«
Verbundprojekt der Forschungsinitiative »EnEff:Stadt«
»KommWPlanPlus – Forschungs- und Entwicklungscluster zur Verknüpfung von kommunaler Wärmeplanung mit der Umsetzungsplanung von integralen Maßnahmen im Quartier, Teilvorhaben Koordination und Schnittstelle Hagen«
- Förderkennzeichen 03EN3087E
- Laufzeit 1.1.2024 – 31.12.2027
- Projektträger Projektträger Jülich GmbH
Projektinfos
Mit Inkrafttreten des Landeswärmeplanungsgesetzes NRW (LWPG) haben die Kommunen den Auftrag nach Landesrecht erhalten, für ihr jeweiliges Stadtgebiet eine Wärmeplanung durchzuführen. Die gesetzliche Grundlage ist das Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze (Wärmeplanungsgesetz - WPG) auf Bundesebene. Der gesetzliche Rahmen umfasst außerdem das Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz - GEG) und das Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) zur Erreichung der nationalen Klimaschutzziele im Gebäudesektor.
Die kommunalen Wärmeplanungen zeigen den gegenwärtigen Zustand sowie ein Zielszenario der Wärmeversorgung im Stadtgebiet auf. Die Wärmeplanungen sind Ausgangspunkt für die Umsetzungsmaßnahmen, mit der die klimaneutrale Wärme-versorgung bis 2045 erreicht werden kann. Hiervon betroffen sind die Sektoren der zentralen und dezentralen Versorgung, die Wohngebäude, das Gewerbe sowie die Industrie und deren Abwärme. Die kommunale Wärmeplanung ist damit die Grundlage zur Orientierung und zur gemeinsamen Planung für alle beteiligten Akteure.
Die Potenziale der Kommunen sollen bestmöglich genutzt und die zeitnahe Um-setzung initiiert werden. Hierfür müssen Schnittstellen und Wechselwirkungen beach-tet und die Wärmeplanung mit anderen kommunalen Planungen integral verschnitten werden. Wichtig ist, dass es nicht nur bei der Planerstellung bleibt, sondern der Pro-zess der Wärmeplanung zügig in eine Umsetzung und Verstetigung gelangt.
Mit dem Projekt KommWPlanPlus wird die kommunale Wärmeplanung mit der Um-setzungsplanung verknüpft und Möglichkeiten zur Verstetigung erarbeitet. Dies erfolgt über die Entwicklung von integralen Planungswerkzeugen. Hierbei werden auch Lösungen zur Sektorenkopplung und die Akteursbeteiligung mit einbezogen.
In KommWPlanPlus werden die kommunalen Wärmeplanungen an den drei Praxis-standorten Wuppertal, Garbsen und Hagen begleitet, neue Werkzeuge und Formate entwickelt und die Zusammenarbeit der lokalen Akteure gestärkt. Zusätzlich werden die Handlungsmöglichkeiten der Kommunen sowie Hemmnisse identifiziert. Ein zu-sätzlicher Fokus liegt auf der Ansprache, Unterstützung und Aktivierung von weiteren Kommunen. Zu diesem Zwecke startet das Fraunhofer UMSICHT die Veranstaltungs-reihe Komm.InFahrt.
Durch die Teilnahme im Projekt flankiert die Stadt Hagen ihre kommunale Wärme-planung auch auf wissenschaftlicher Basis und möchte diese, unter Verwendung der zu entwickelnden Methoden, zielgerichtet in die Umsetzung bringen.
Partner
- Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT Oberhausen (Projektkoordination)
- Stadt Wuppertal
- WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH
- Stadt Garbsen
- Stadtwerke Garbsen GmbH
- Stadt Hagen
- Enervie Service GmbH, Hagen
- items project GmbH & Co. KG, Berlin
- Civitas Connect e. V., Münster
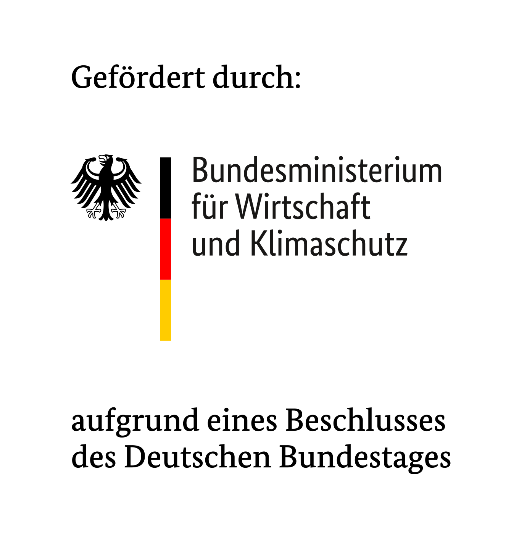
Nach oben.
Standort & Erreichbarkeit
Umweltamt
Rathausstraße 11, 58095 Hagen
Ansprechpartner
Abteilungsleiterin
Telefon: 02331 207 3501
stellv. Abteilungsleiter
Telefon: 02331 207 3763
Projekt KommWPlanPlus
Telefon: 02331 207 2798